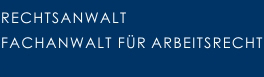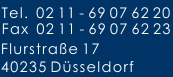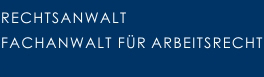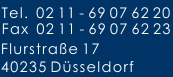|
Die Strafanzeige als arbeitsrechtliches Risiko
Die Erstattung einer Strafanzeige durch einen Arbeitnehmer gegen den Vorgesetzten kann erhebliche arbeitsrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.
Arbeitgeber sehen sich mit der Frage konfrontiert, ob das Vertrauen zum Arbeitnehmer so stark beschädigt ist, dass eine verhaltensbedingte Kündigung gerechtfertigt ist.
Arbeitnehmer müssen sich hingegen fragen, ob die Anzeige berechtigt ist oder als Pflichtverletzung gewertet werden könnte. Bereits eine Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts aus dem Jahr 20023 (BAG, Urteil vom 3. Juli 2003 – 2 AZR 235/02) lieferte wichtige Leitlinien zur Beurteilung dieser Fälle.
1. Einführung: Die Problematik der Strafanzeige im Arbeitsverhältnis
Wenn ein Arbeitnehmer seinen Vorgesetzten bei der Polizei z.B. wegen Verleumdung oder falscher Behauptungen anzeigt, stellt sich die Frage, ob und inwieweit er damit arbeitsrechtliche Konsequenzen, insbesondere eine verhaltensbedingte Kündigung, riskiert. Grundsätzlich kann das Erstatten einer Strafanzeige eine Verletzung der arbeitsvertraglichen Nebenpflichten darstellen.
Allerdings hat die Rechtsprechung – insbesondere das Bundesarbeitsgericht (BAG) – klargestellt, dass nicht jede Anzeige automatisch als Pflichtverletzung gewertet werden darf.
Zum Seitenanfang
2. Grundsatz: Schutz der Strafanzeige durch das Rechtsstaatsprinzip
Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG, Beschluss vom 2. Juli 2001 – 1 BvR 2049/00) hat entschieden, dass ein Arbeitnehmer grundsätzlich das Recht hat, eine berechtigte Strafanzeige gegen seinen Arbeitgeber oder Vorgesetzten zu erstatten, ohne deswegen eine Kündigung befürchten zu müssen. Dies ergibt sich aus dem Rechtsstaatsprinzip (Art. 20 Abs. 3 GG) und der Wahrung der Rechtsweggarantie. Allerdings ist der Schutz nicht unbegrenzt:
Wenn die Anzeige auf wissentlich falschen oder leichtfertig falschen Tatsachen beruht, kann dies eine verhaltensbedingte Kündigung rechtfertigen.
Auch bei einer missbräuchlichen Anzeige, etwa wenn der Arbeitnehmer aus persönlichen Rachemotiven handelt oder die Anzeige unverhältnismäßig ist, besteht ein Kündigungsrisiko.
Das BAG hat hierzu in seinem Urteil vom 3. Juli 2003 (Az. 2 AZR 235/02) klargestellt, dass es immer auf den konkreten Einzelfall ankommt.
Zum Seitenanfang
3. Voraussetzungen einer verhaltensbedingten Kündigung
Eine verhaltensbedingte Kündigung setzt gemäß § 1 Abs. 2 KSchG voraus, dass der Arbeitnehmer seine vertraglichen Pflichten schuldhaft und erheblich verletzt hat. In Bezug auf eine Strafanzeige gegen den Vorgesetzten sind insbesondere folgende Aspekte zu prüfen:
a) Wissentlich falsche oder leichtfertige Angaben
Ein Arbeitnehmer, der in seiner Anzeige wissentlich falsche Behauptungen aufstellt oder ohne ausreichende Tatsachengrundlage leichtfertig Vorwürfe erhebt, kann eine vertragswidrige Pflichtverletzung begehen. In solchen Fällen ist eine fristlose oder ordentliche verhaltensbedingte Kündigung in der Regel zulässig. Die Beweislast dafür, dass die Anzeige falsche oder leichtfertige Angaben enthält, liegt jedoch beim Arbeitgeber.
b) Motivation und Verhältnismäßigkeit der Anzeige
Das BAG hat klargestellt, dass die Motivation des Arbeitnehmers und die Verhältnismäßigkeit seiner Reaktion entscheidend sind. Eine Anzeige, die aus rein persönlichen Motiven (z. B. aus Rache) erfolgt, kann als Missbrauch der Rechtsverfolgung gewertet werden und zur Kündigung führen. Dagegen ist eine Anzeige, die auf berechtigten oder zumindest vertretbaren Gründen beruht, grundsätzlich geschützt.
c) Versuch der internen Klärung
Das BAG verlangt nicht zwingend, dass der Arbeitnehmer den Vorfall zuerst intern klärt, bevor er eine Strafanzeige erstattet. Eine Ausnahme besteht jedoch, wenn eine interne Klärung zumutbar und erfolgversprechend ist.
Ist dem Arbeitnehmer bekannt, dass die Vorwürfe intern geregelt werden könnten, ohne dass er Nachteile befürchten muss, könnte das Unterlassen einer internen Klärung als Pflichtverletzung gewertet werden.
Liegt jedoch ein schwerwiegender Vorwurf vor (z. B. eine Straftat), ist die direkte Einschaltung der Strafverfolgungsbehörden gerechtfertigt.
Zum Seitenanfang
4. Interessenabwägung: Zentrales Kriterium für die Rechtmäßigkeit der Kündigung
Im Rahmen der verhaltensbedingten Kündigung ist eine umfassende Interessenabwägung vorzunehmen. Diese Abwägung berücksichtigt:
Das Interesse des Arbeitgebers: Schutz des Betriebsfriedens, Vermeidung von Rufschädigung, Schutz vor missbräuchlichen Anzeigen.
Das Interesse des Arbeitnehmers: Wahrung der Rechtsweggarantie, Schutz vor unberechtigten Vorwürfen des Arbeitgebers oder Vorgesetzten.
Das BAG hat in seinem Urteil klargestellt, dass eine Kündigung nur dann gerechtfertigt ist, wenn die Anzeige das Vertrauensverhältnis so stark belastet, dass dem Arbeitgeber die Fortführung des Arbeitsverhältnisses nicht mehr zuzumuten ist.
Zum Seitenanfang
5. Wann ist eine Kündigung unwirksam?
Eine Kündigung ist unwirksam, wenn:
Die Strafanzeige auf nachvollziehbaren und objektiven Gründen beruht.
Der Arbeitnehmer in gutem Glauben gehandelt hat, auch wenn sich die Vorwürfe später als unzutreffend herausstellen.
Keine Anhaltspunkte für eine missbräuchliche Motivation des Arbeitnehmers bestehen.
Zum Seitenanfang
6. Sonderfall: Hinweisgeberschutz nach dem HinSchG
Das Hinweisgeberschutzgesetz (HinSchG), das die EU-Whistleblower-Richtlinie umsetzt, schützt Arbeitnehmer, die Rechtsverstöße oder Missstände melden. Der Schutz greift insbesondere, wenn die Anzeige auf Verstöße gegen das Gesetz oder Gefahren für die Allgemeinheit abzielt. In solchen Fällen ist eine Kündigung nur schwer durchsetzbar.
Zum Seitenanfang
7. Fazit und Handlungsempfehlung
Eine Strafanzeige gegen den Vorgesetzten birgt arbeitsrechtliche Risiken, insbesondere dann, wenn sie auf falschen oder leichtfertigen Behauptungen beruht oder aus rein persönlichen Motiven erfolgt.
Vor der Anzeige sollte der Arbeitnehmer sorgfältig prüfen, ob die Vorwürfe belegbar sind.
Eine vorherige betriebsinterne Beratung oder Klärung ist in vielen Fällen ratsam, vor allem wenn die Umstände dies zumutbar machen.
Fachanwaltliche Beratung ist dringend anzuraten, um Risiken zu minimieren und die rechtlichen Schutzmechanismen – z.B. den Hinweisgeberschutz – korrekt anzuwenden.
Zum Seitenanfang
|